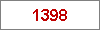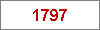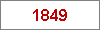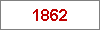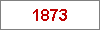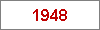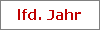Chronik einer Insel
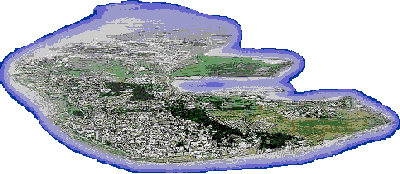
Chronik der Insel | Betriebe und Einrichtungen | Insel und Küste | Insel und Stadt Historisch | Küstenschutz | Presse | Vereine
Bodenstab (Bau) | Fliegerhorst | Freiwillige Feuerwehr | Giftbude | Haus Ihnken, Damenpfad | Hotel Germania | Inselkirche | Kinderkurheim Arnsberg | Kurverwaltung | Norderneyer Badezeitung | Norderneyer Schulen | OLB | Postamt | Reederei Norden Frisia | Seehospiz | Stadtwerke | Tischlerei Stürenburg | Wilhelm-Augusta-Heim
 Betriebe und Einrichtungen | Stadtwerke
Betriebe und Einrichtungen | Stadtwerke1989 - 100 Jahre Stadtwerke Norderney
 Dieser Lüftungsturm mit einer Höhe von rund 14 Metern wurde auf der Kapdüne errichtet. Das Wasser wurde zunächst in ein oberes Gefäß geleitet, von wo es durch zwei Röste aus engliegenden Stäben herabrieselte, und durch die auf allen vier Seiten des Turmes durchbohrten Wandungen dem Luftstrom ausgesetzt war. Das in einem Sammelbecken unten im Turm aufgefangene Wasser wurde über eine "mehrfach geknickte Rohrleitung bei natürlichem Uberdruck von etwa 4,7 m in das Reservoir der Georgshöhe, östlich neben der "sogenannten Giftbude", geleitet. Dieser aus Klinkern und Zementmörtel wasserdicht gemauerte Wasserbehälter war 14,30 m lang, 9,0 m breit und hatte eine Höhe von 3,50 m. Von der Georgshöhe wurde eine Hauptverteilerleitung durch die Knyphausenstraße verlegt und bis zum Kreuzungspunkt mit der Moltkestraße geführt, wo sich das Haupt-Umlaufsystem anschloß. Eine zweite direkte Leitung wurde vom Maschinenhaus durch die Gartenstraße bis zum Schnittpunkt mit der Janusstraße geführt. Das Ortsnetz wurde nach dem sogenannten Umlaufsystem angelegt, das heißt, mit wenigen Ausnahmen wurden Straßenleitungen vermieden, von denen ein Ende ohne Verbindung mit der Hauptleitung blieb. Das Ortsnetz hatte 1889 eine Länge von rd. 10 km. Im Jahre 1898 wurde es um 1,8 km erweitert. Für Feuerlöschzwecke waren in einer durchschnittlichen Entfernung von siebzig Metern 67 Hydranten aufgestellt worden.
Dieser Lüftungsturm mit einer Höhe von rund 14 Metern wurde auf der Kapdüne errichtet. Das Wasser wurde zunächst in ein oberes Gefäß geleitet, von wo es durch zwei Röste aus engliegenden Stäben herabrieselte, und durch die auf allen vier Seiten des Turmes durchbohrten Wandungen dem Luftstrom ausgesetzt war. Das in einem Sammelbecken unten im Turm aufgefangene Wasser wurde über eine "mehrfach geknickte Rohrleitung bei natürlichem Uberdruck von etwa 4,7 m in das Reservoir der Georgshöhe, östlich neben der "sogenannten Giftbude", geleitet. Dieser aus Klinkern und Zementmörtel wasserdicht gemauerte Wasserbehälter war 14,30 m lang, 9,0 m breit und hatte eine Höhe von 3,50 m. Von der Georgshöhe wurde eine Hauptverteilerleitung durch die Knyphausenstraße verlegt und bis zum Kreuzungspunkt mit der Moltkestraße geführt, wo sich das Haupt-Umlaufsystem anschloß. Eine zweite direkte Leitung wurde vom Maschinenhaus durch die Gartenstraße bis zum Schnittpunkt mit der Janusstraße geführt. Das Ortsnetz wurde nach dem sogenannten Umlaufsystem angelegt, das heißt, mit wenigen Ausnahmen wurden Straßenleitungen vermieden, von denen ein Ende ohne Verbindung mit der Hauptleitung blieb. Das Ortsnetz hatte 1889 eine Länge von rd. 10 km. Im Jahre 1898 wurde es um 1,8 km erweitert. Für Feuerlöschzwecke waren in einer durchschnittlichen Entfernung von siebzig Metern 67 Hydranten aufgestellt worden.
Die Abwässer des Ortes wurden über zwei Hauptleitungen, beginnend an der Ecke Herrenpfad/Schafweg (heute Jann-Berghaus-Straße) und von der Gartenstraße/Kreuzung Herrenpfad unter Ausnutzung des Gefälles zum Sammelbassin nahe des Maschinenhauses geführt. In beide Leitungen mündeten die dem Straßennetz angepaßten Verästelungen. Aus dem Sammelbassin - heute noch in Betrieb - wurden die Abwässer über Saugpumpen durch eine 1790 m lange Druckrohrleitung zu den Rieselfeldern geleitet. Das Rohr endete in einem hölzernen Bassin, von wo aus das Wasser über einen Hauptbewässerungskanal, der sich wieder teilte, in gesonderte Flächenabschnitte des Rieselfeldes geleitet werden konnte. Eine direkte Leitung wurde auch in das Watt geführt.